Schleißheim kenne er wohl, schrieb der angehende Berner Kunstmaler Paul Klee 1903 in einem belanglosen Austausch an seine damalige Verlobte Lily Stumpf.
Wie Dutzende Künstler aus unterschiedlichsten Generationen und Stilrichtungen hatte er während seiner Lehrjahre an der Münchner Kunstakademie den malerischen Ort besucht und sich vielleicht auch die Gemäldegalerie im Schloss angesehen; 1910, als die junge Familie schon in München lebte, gestaltete er eine Federzeichnung vom Schloss, die er als Werk 52 (1910) in sein buchalterisches Werkverzeichnis aufnahm. Der große europäische Krieg seit 1914 aber schuf eine ganz einzigartige Verbindung ausgerechnet diese heute weltberühmten Künstlers mit Schleißheim: Fünf Monate und fünf Tage war der Gefreite Klee 1916/17 am Militärflugplatz Schleißheim stationiert und bemalte dort Kriegsflugzeuge.
Mit schneidigem Hurra und im Handstreich wollten alle teilnehmenden Mächte den im August 1914 begonnen Krieg rasch gewinnen. Anfang 1916 aber hatte sich das Kampfgeschehen schon erkennbar festgefressen. Die enormen Verluste an den Fronten führten zur Rekrutierung immer weiterer Jahrgänge und so ereilte Anfang März auch den 36jährigen Familienvater Paul Klee die Einberufung.
Klee hatte den großen Krieg wie viele Künstler der Zeit als geistiges Ereignis wahrgenommen und gedeutet, als äußeres Manifest einer tiefen und grundlegenden Umbruchsphase europäischer Werte und Kultur, wie sie von sehr vielen Malern und Literaten ersehnt worden war, die dann teilweise auch den Krieg begrüßten. Klee scheint dagegen eher eine „Indifferenz“ an den Tag gelegt zu haben, wie sie sein glühend begeisterter Freund und Kollege Franz Marc in einem Brief aus dem Feld an Klee kritisierte. Marc fiel am 4. März 1916, die Todesnachricht erreichte den Freund am gleichen Tag wie seine eigene Einberufung. August Macke, mit dem Klee noch im April 1914 eine für ihn wegweisende Tunesienreise unternommen hatte, gehörte im Herbst 14 zu den ersten Gefallenen des Krieges.
Klee kam als Rekrut nach Landshut. Seine Militärzeit kommentierte er in seinen umfassenden Tagebuchaufzeichnungen überwiegend gelassen und spöttisch, spricht von der „Generalkostümprobe“, wenn alle in Uniform antraten, bezeichnet die abgeschiedene Garnison als „letztes Aufgebot“. Seine schließliche Versetzung nach Schleißheim gestaltete er in seinem Tagebuch ganz im spöttischen, fast heiteren Duktus dieser Tage als regelrechte Posse. „Als es mir gut zu gefallen begann bei diesem Truppenteil wurde einmal plötzlich auf dem Exercierplatz mein Name gerufen. Der Feldwebel empfing mich sehr aufgeräumt. Wollens nicht fliegen? Ich? Ja, Sie haben sich doch zu den Fliegern gemeldet! Verzeihung Herr Feldwebel ich weiß nichts davon. Nun damit Sie sich auskennen, wir haben Eana g’meldet“. Als er nach Arzt und Papierkram zum Feldwebel zurückkehrte, „war ich schon versetzt“, erzählt er launig weiter, „er gratulierte mir: San’s froh daß’S von dere windigen Infantrie wegkommen. Grüß Gott Klee, lassen sich’s gut gehn!“
Definitiv aufklären lässt sich diesese Episode nicht; einzelne Biografen vermuten hinter der unverhofften Versetzung einen geheimen hoheitlichen Erlass, nicht weitere Prominente an der Front sterben zu lassen. Sohn Felix erinnerte sich, dass die Mutter Lily „alle Hebel in Bewegung gesetzt“ habe, um Klee die Front zu ersparen und einen ungefährlichen Posten im Hinterland zu verschaffen. Ob der Maler Mitte 1916 schon so populär war, dass sein eventueller Heldentod auf die Moral weiter Kreise hätte drücken können? Zwar stellte er seit 1908 vorwiegend in Gruppenausstellungen aus, aber in der Überblicksliteratur wird sein künstlerischer und kommerzieller Durchbruch erst auf 1918 taxiert.
Paul Klee rückte also zusammen mit dem Münchner Bühnenbildner Hans Wildermann, der denselben Versetzungsbefehl erhalten hatte, nach Schleißheim ab. Die Seite 1013 seiner Tagebücher trägt nun in schwarzer Tinte die Seitenüberschrift „Schleißheim“, mehrere folgen. „In Schleißheim angekommen, nahm uns ein greulich verlotterter Posten mit Filztschakko in Empfang“, begann er seinen ersten Tagebucheintrag vom Militärflugplatz, „das war schon ein Grad weniger, als wir gewohnt waren. Ein gewisses Decorum war ja bei der Infantrie gewesen.“ Antritt in der Kaserne, „einem Bau wo alles eng und klein war, wenn auch neu“, Formalien, Stempel, Einweisung, und dann: „Wir gehörten zur ‚Werftkompagnie‘.“
Der Flugplatz Schleißheim war 1912 als erster Militärflugplatz des Königreichs Bayern für dessen neue „Luftschiffer- und Kraftfahrabteilung“ begründet worden und seitdem wurden die Bayerischen Fliegertruppen dort aufgebaut. In der Kriegsorganisation wurde der junge Flugplatz zum Standort einer Fliegerersatzabteilung, die für die Ausbildung des fliegenden Personals und die Ausrüstung der Flugzeuge zuständig war. Als Klee antrat, gab es eine Fliegerschule, in der angehende Piloten in durchschnittlich drei Monaten für den Fronteinsatz fit gemacht wurden, und eben die Werftkompanie als technische Einheit, in der die Flugzeuge gewartet und gegebenenfalls repariert wurden. Aus der Zeit, als Klee hierher versetzt wurde, ist heute nur mehr die damalige Kommandantur als Teil des Deutschen Museums erhalten. Die Flugwerft, die mit dieser Kommandantur den historischen Kern des Museums bildet, wurde erst 1918 gebaut. Wo jetzt die 1992 errichteten gläsernen Ausstellungshallen liegen, war 1916 die Werfthalle, in der Klee zu arbeiten hatte.
Registriert in der Kaserne wurden er und Wildermann ausdrücklich nicht als Maler, sondern als Kunstmaler, berichtet sein Tagebuch weiter vom Ankunftstag in Schleißheim, „wir erregten damit etwas Kopfschütteln. Nur der Kompagnieschreiber war erfreut. Wir würden jetzt gerade eine Arbeit bekommen, an der wir unsere Kunst erproben könnten. Nun ins Quartier: Kirchenspeicher.“ Und später am Tage: „Die Appelle, der Feldwebel. Die Werft die Arbeit dort. Proletarier, Fabrikarbeiter. Stubenvoll. 3 Wochen Urlaub.“
Seine „Kunst erproben“ konnte Klee dann bei der Bemalung von Flugzeugen. Grundsätzlich waren die Maschinen dieser Generation bereits „ab Werk“ mit einer Haut in Tarnfarben bespannt, so dass die grundlegende Gestaltung nicht Aufgabe der Werftkompanie war; vielmehr waren hier Reparaturen und Korrekturen vorzunehmen oder Erkennungzeichen und Seriennummern mit Schablonen aufzutragen, deren Systematik sich während des Krieges mehrfach änderte. Seiner Ehefrau Lily schrieb Klee gleich am 12. August, seinem ersten regulären Diensttag: „Ich streiche Staffeleien mit Lack an. Gefährlich ist das ja nicht. Aber plötzlich Fabrikarbeiter zu sein, wie abenteuerlich! Und das Gewand!“
In einem Brief an seinen Freund Alfred Kubin im September beschrieb er seine Tätigkeit: „Ich streiche Aeroplane samt Zubehör an.“ Und im Oktober hielt er im Tagebuch fest: „Zwei Wandtafelgestelle lasiert. An Aeroplanen die Nummern ausgebessert, neue vorn hinschabloniert“. Dazu wurde er auch immer wieder zu anderen Arbeitseinsätzen herangezogen. „Ich war draußen beschäftigt mit Wagenhalten beim Motorenumladen“, schrieb er seiner Ehefrau im November, „es tat gut“.
Einquartiert war der Gefreite Klee zunächst im sogenannten Kirchenspeicher, der am Südende des Alten Schlosses am Übergang zur Schlosswirtschaft durch den Einzug einer Zwischendecke über der ehemaligen Hofkapelle geschaffen worden war. Obwohl Oberschleißheim, das zu Kriegsbeginn 1380 Einwohner gezählt hatte, durch den Zuzug im Gefolge des rasch wachsenden Flugplatzes schier aus allen Nähren platzte, konnte sich Klee doch bald bei der Familie Schindelbeck an der Dachauer Straße einmieten und so der Massenunterkunft am Flugplatz entkommen. Das eingeschossige Haus existiert heute nicht mehr; nach Recherchen des Schleißheimer Heimatforschers und Klee-Experten Otto Bürger, auf dessen Forschungen viele weitere Details gründen, lag es rund fünf Gehminuten zum Bahnhof und wenig mehr zum Flugplatz.
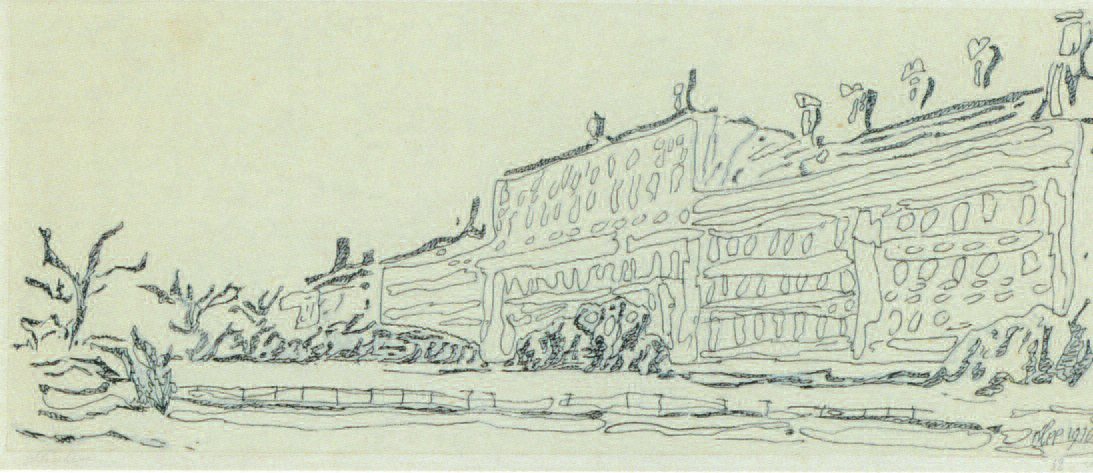
Hier wurde Klee auch regelmäßig von seiner Familie aus München besucht. Kurz vor Weihnachten hielt er fest: „Der Ofen in m. Schleißh. Bude raucht. Besen u. Schaufel gekauft. Kaminkehrer her. (Fand einen Lumpen im Rohr.)“ Und tags drauf: „Der Ofen ist jetzt gut, nachdem der Lumpen heraus. Die Meinen können mich wieder besuchen.“
Zweifellos hat Klee in dem Haus an der Dachauer Straße auch gemalt. In einem Brief an Kubin im Januar 1917, also unmittelbar nach Abschied nach Gersthofen, schrieb er von „circa 40 neuen Arbeiten, welche zeitlich in Schleißheim entstanden“. Definitiv aus seinen Aufzeichnungen für das Haus an der Dachauer Straße nachweisbar ist die Überarbeitung und Kolorierung der 1915 als Schwarzweißdurck entstanden Lithographie „Zerstörung und Hoffnung“, die er nach der Farbgebung im Oktober 1916 als eigenständiges Werk unter der Nummer 55 (1916) in sein Verzeichnis aufnahm. Folglich könnten einige Werknummern davor und über 30 danach in Schleißheim entstanden sein, wobei trotz der peniblen Buchführung Klees die Chronologie nicht belastbar ist, da er die Werke nicht zwangsweise bei der Fertigstellung auch gleich katalogisierte.
Überhaupt ist die Schleißheimer Zeit in Klees Leben wie Werk schwer greifbar. 1915 hatte er 255 Werke geschaffen, 1916 mit den fünf Monaten in Schleißheim gerade 81, 1917 schon wieder 162, 1918 dann 211 und 1919 wieder 265. Offenbar war er im Dienst an der Flugwerft auch ziemlich unglücklich. In einer Zusammenstellung autobiografischer Fakten für eine von Wilhelm Hausenstein geplante Monografie über ihn skizzierte Klee 1919 die Zeit in Schleißheim rückblickend: „Ende August Fliegerersatzabteilung als Handwerker versetzt. Zuerst Fabrikarbeiter an der Werft (Anstreicher). Die ‚Kollegen‘ an der Werft schätzen mich nicht.“
Nach der Versetzung im Januar 1917 nach Gersthofen begründete er dies in einem der ersten Briefe an Ehefrau Lily mit „meinem schlechten Verhältnis zur Werft“. Er sei „sicher, daß man mich in der Werft weghaben wollte“. Mehrmals erwähnte er einen „sächselnden Herrn Werkmeister“, ein Vorgesetzter, mit dem er wohl in gegenseitiger Abneigung verbunden war. An Freund Kubin schrieb er Anfang 1917 über die Werftkompanie: „Dort ist so eine Art Hölle eingerichtet man arbeitet aber mehr mit Intrigue als mit scharfer Munition. Lange Zeit stand ich da in einer Art feindlichem Feuer und konnte nie den Stand dieser perfiden Batterie herausbekommen.“
Der Umgang des Künstlers, der sich auf seiner Stube mit Theorien der Abstraktion und der Lektüre chinesischer Lyrik beschäftigte, mit Leuten, für die er auf den ersten Blick nur ein Wort – „Proletarier“ – übrig hatte, war sicher nicht unkompliziert. Vielleicht hatte der Gefreite Klee in den Augen seiner Kollegen, von denen er sich noch im Tagebuch mit Anführungszeichen distanzierte, auch ein paar Vergünstigungen zu viel erhalten. Die Versetzung an die Werft ersparte ihm die Front, am Tag seines Dienstantritts erhielt er drei Wochen Sonderurlaub, um die Gedenkausstellung zu Ehren seines gefallenen Freundes Franz Marc zu kuratieren, und ab November war er praktisch kaum noch in der Werft, weil er nacheinander mit drei Flugzeugtransporten nach Nord- und Westdeutschland betraut war; quasi Dienstreisen auf Spesen wie „eine schöne Speckseite“, die er zur Abreise erhielt.
Auf diesen Zugreisen zur Begleitung von Flugzeugen, die zum Fronteinsatz transportiert wurden, lebte er auf. Im Tagebuch, das seit dem Einzug in Schleißheim einsilbig wird und große Lücken aufweist, protokollierte er nun wieder elanvoll die Reiseerlebnisse bis hin zur Zusammensetzung des Frühstücks. Auch wenn die zweite Reise sein gefährlichstes Kriegserlebnis wurde, weil er zwei Aeroplane unmittelbar ins Kriegsgebiet, nach Cambrai, begleiten musste, als Vorsichtsmaßnahme nur nachts reisen durfte und im ungeheizten Zug lausig fror, so ist der Gefühlsaufschwung zur tristen Zeit in der Werft doch spürbar. Die Rückkehr verlängerte er um einen Tag bei der Familie in München und anschließend erhielt er sofort Weihnachtsurlaub. Als er danach seinen Sold abholte, juxte er: „10 Mark 50 Pfennig verdient durch Urlaub. Das Militär hat auch lichte Momente.“
Nach seiner dritten Transportbegleitung an die Nordsee hängte Klee wieder eigenmächtig einen Besuch bei der Familie an. „Meine militärischen Schicksale sind nicht schwer, aber überraschungssicher“, notierte er danach ins Tagebuch: „Ich komme aus meinem geheimen Urlaub zurück und finde mich nach der Fliegerschule 5 versetzt. Da es wahrscheinlich heute noch dahin geht, kann ich in meinem Zimmer wohl noch etwas Ordnung machen, mehr nicht.“
Weil der Standort Schleißheim mit dem immer größeren Personalbedarf der fliegenden Kräfte überfordert war, baute die Militärführung sechs neue Fliegerschulen auf, darunter eine in Gersthofen bei Augsburg, wohin Klee nun abkommandiert wurde. „Das reine Naturereignis so eine Versetzung“, schrieb er nach der Ankunft, „nach 12 Stunden kopdschüttle ich immer noch. Ich soll dort Obermaler sein! In Schleißheim soll nur der Stamm bleiben, zu dem ich nicht gehöre. Mein Schutzgeist wird schon wissen was er tut. Ein Abenteuer mehr, damit der Krieg nicht zu fad wird.“
1917, in Gersthofen, registriert Klee in sein Werkverzeichnis zwei Bilder, die nach Otto Bürgers Interpretation Schleißheimer Motive wiedergeben. In „Ein Schiff will aus dem Kanal“, Werknr. 16 (1917), sieht Bürger die Basis des Bildes im Blick aus Klees Zimmer an der Dachauer Straße über den Dachauer Kanal auf die damals „auf der grünen Wiese“ neu erbaute Veterinäranstalt, Urzelle des heutigen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, mit ihrem charakteristischen Türmchen. Und die Bleistiftzeichnung „Das Glöckchen“, 22 (1917), soll den Uhrturm des Alten Schlosses zeigen. Schloss und Schlosspark, die über die Jahrzehnte hunderte Maler unterschiedlichen Talents angezogen haben und die auch Klee bei seinem Ausflug 1910 wie selbstverständlich in den Blick genommen hatte, hat er in seiner Dienstzeit einen Steinwurf weiter nicht einmal zu Papier gebracht.
Tiefergehende Anregungen und Motive aus seiner Militärzeit allgemein und der Schleißheimer Wochen speziell dürften aber vielfältig sein. Speziell das Fliegen ist im Werk wie in der Gedankenwelt Paul Klees ein zentrales Motiv – und wie viele Facetten dazu lernte er auf einem Flugplatz und in einer Flugwerft neu oder vertieft kennen! Am 10. November 16 notierte er, er habe „den kaputten Aeroplan aufräumen helfen, auf dem 2 Flieger vorgestern ihr Leben liessen.“ Angesichts der Flugtechnik in den Kinderschuhen und der rasanten Ausbildung waren Abstürze an der Tagesordnung, auch mit tödlichem Ausgang. „Übel zugerichteter Motor“, heisst es im Tagebucheintrag weiter, „ganz stimmungsvolle Arbeit?“ Er wolle sich bemühen, nicht mehr so viel dieser Arbeitsgruppe zugeteilt zu werden: „Dann hab ich wenigstens das Erlebnis mit der gestürzten Maschine gehabt.“
Bilder wie „Vogel-Flugzeuge“, 210 (1918), oder „Fliegersturz“, 209 (1920), setzen diese Erlebnisse und Eindrücke, wenn auch mit deutlicher Zeitverzögerung, so doch unverkennbar um. Das Deutsche Museum hat Bilder aus diesem Themenkreis in einer großen Sonderausstellung 1997 unter dem Titel „Und ich flog. Paul Klee in Schleißheim“ zusammengestellt und ihren Kontext analysiert. Der Titel der Schau war dabei lyrisch und pointiert; geflogen aber ist Klee in seiner Militärzeit als „Fabrikarbeiter“ nie.
Ein etwas exotisches wiederkehrendes Motiv in Klees Oeuvre ist etwa ein senkrecht nach unten ragender oder stürzender Pfeil in diversenen Variationen und Kontexten – wie augenfällig aber wird „Das Haus zum Fliegerpfeil“, 56 (1922), oder auch die „Betroffene Stadt“, 22 (1936), wenn daneben originale Fliegerpfeile hängen, wie sie Klee in Schleißheim kennengelernt haben muss, Pfeile aus Metall, die als naive Vorläufer von Bomben zu Weltkriegsbeginn aus den Flugzeugen abgeworfen wurden.
Flugplatzutensilien wie eine Drachenwinde („Drachenwagen am Flugplatz“, 501/1939) oder „Ballon, Windmesser, Fahne, Gestirne“, 17a und b (1917), hat Klee in seiner Bildsprache festgehalten. Und wie grenzenlos lässt sich über die vielfältigen Zeichen und schablonenhaften Symbole in Klees abstrakten Werken spekulieren, was daran von seinen Wahrnehmungen beim „Hinschablonieren“ an die Aeroplane in der Flugwerft Schleißheim herzuleiten ist. In der Ausstellung des Deutschen Museums wurden etwa das fragmentarische Aquarell „E“, 199 (1918), oder „43“, 145 (1928), mit einiger Plausibilität direkt auf die Arbeit in der Werft zurückgeführt. Und wenn ein zeitlich wie thematisch weit entferntes Gemälde wie der „Park bei Lu“, 129 (1938), die Kuratoren der Ausstellung in der Flugwerft so frappierend an die Tarnfarben eines Weltkriegsflugzeugs erinnerte, kann dies auch vielleicht ein Deutungsansatz sein, wie viel seiner Militärzeit in Klee haften blieb.
Wie wenig produktiv Paul Klee in Schleißheim auch gewesen sein mag – umso mehr hat er in dieser extremen Lebensphase immerhin in einem Weltkrieg vielleicht an Eindrücken und Wahrnehmungen aufgenommen und verinnerlicht? Er selbst reflektierte darüber schon im Herbst 1917 in einer erkennbar melancholischen Stimmung nach einem längeren Urlaub mit der Familie: „Die Zeit ist gewiss nicht leicht aber voller Aufschlüsse. Ob meine Arbeit bei gelassenem Weiterleben auch so schnell emporgeschossen wäre wie Anno 1916/17? Ein leidenschaftlicher Zug nach Verklärung hängt doch wohl mit der großen Veränderung der Lebensführung zusammen.“
Er sei durch Krieg und Militärdienst „immer tiefer in eine Welt jenseits der Realität eingedrungen“, schrieb Kuratorin Margareta Benz-Zauner in der Jubiläumsausstellung des Deutschen Museums. Klee hatte diese Entwicklung schon bald nach Kriegsbeginn in einem lyrischen Ausbruch in seinem Tagebuch vorweg empfunden:
„Ich meinte zu sterben, Krieg und Tod.
Kann ich denn sterben, ich Kristall?
ich Kristall
Ich habe diesen Krieg in mir längst gehabt. Daher geht er mich innerlich nichts an.
Um mich aus meinen Trümmern herauszuarbeiten musste ich fliegen. Und ich flog.“
